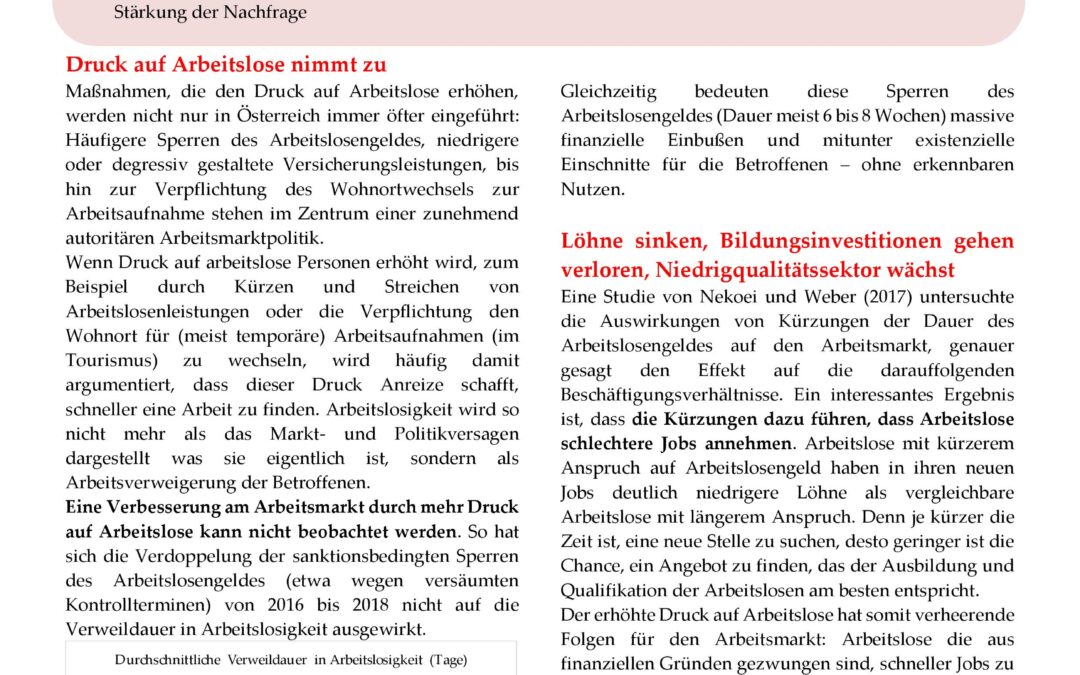
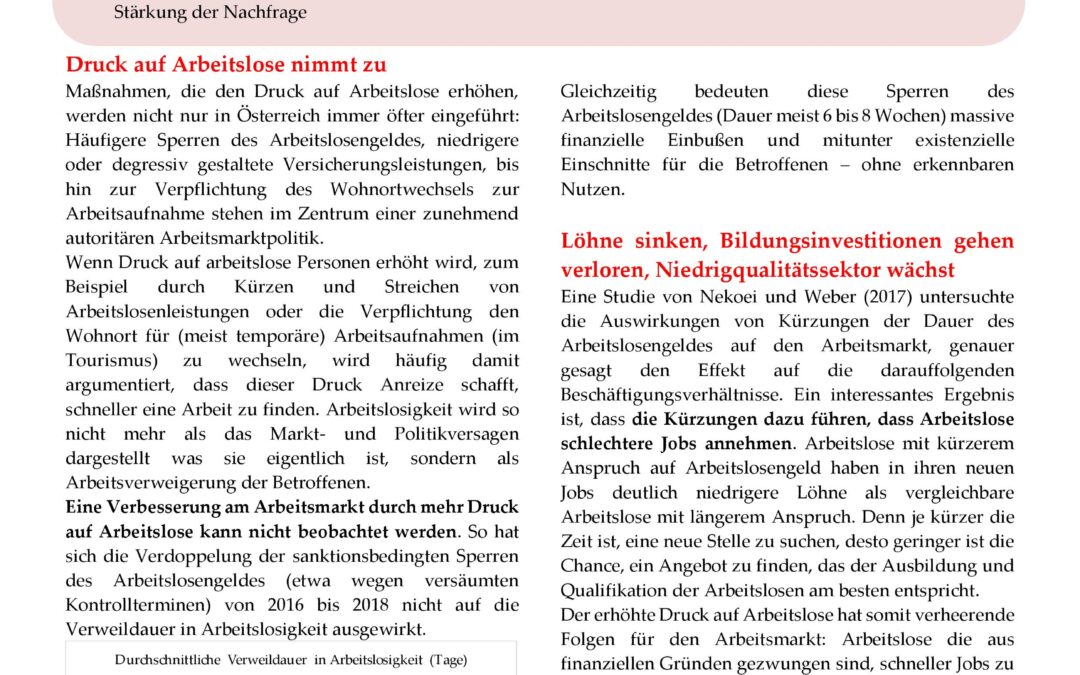
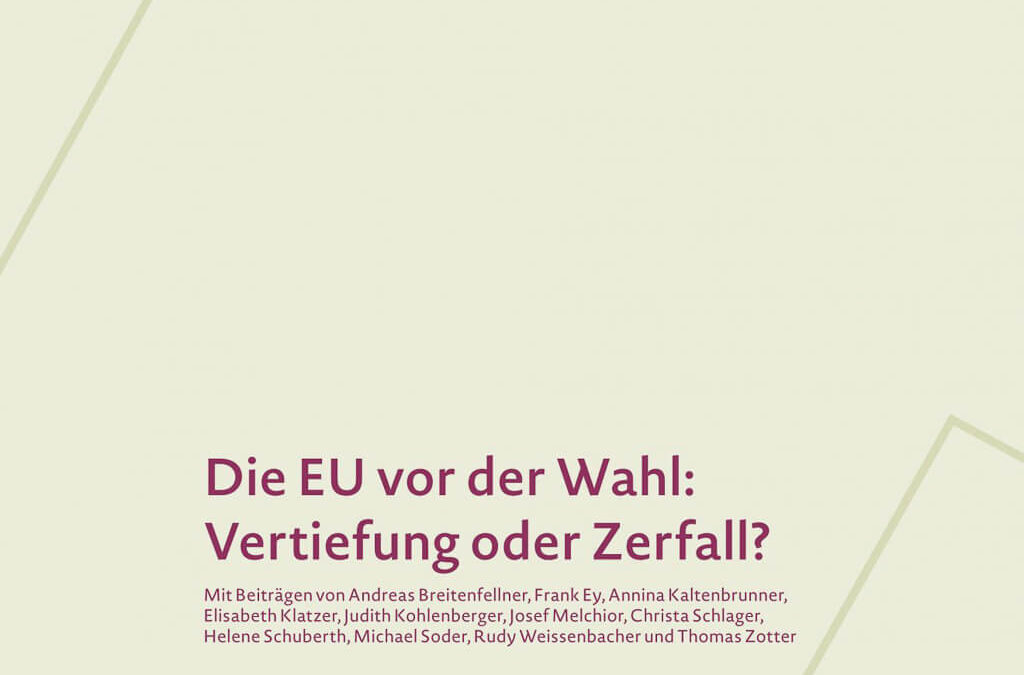
Der neue Kurswechsel ist da: Die EU vor der Wahl – Vertiefung oder Zerfall?
Die Entwicklungen der letzten Monate verstärken den Eindruck: Das gemeinsame politische Projekt der EU könnte nun endgültig an einem Scheideweg angelangt sein. Kurz vor der Wahl zum Europäischen Parlament setzt sich dieses Heft deshalb mit Fragen des Zerfalls oder...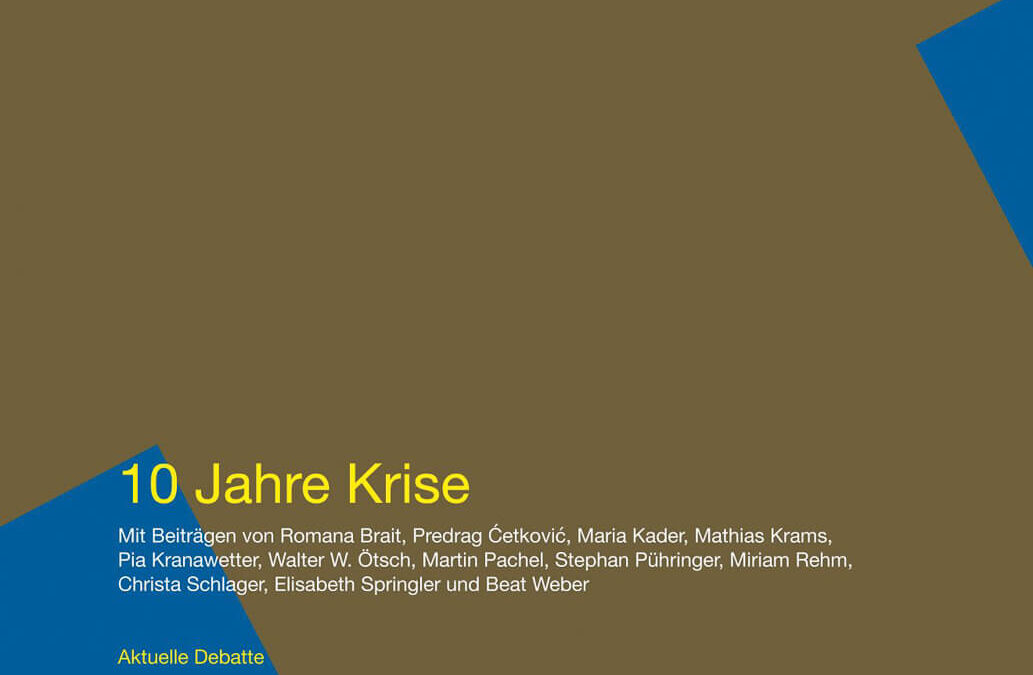
Der neue Kurswechsel ist da: 10 Jahre Krise
Zehn Jahre sind nun seit dem Ausbruch der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise vergangen. Aus diesem Anlass widmet sich das aktuelle Heft ausführlich dem Thema Krise. Das neue Heft geht der Frage nach, ob es gelungen ist in den letzten 10 Jahren die systemischen...
Just Transition: Klimaschutz demokratisch gestalten!
Die Notwendigkeit Die Auswirkungen der von Menschen gemachten Klimakrise werden weltweit immer stärker spürbar. Naturkatastrophen drohen ganze Ernten zu vernichten, Nahrungsmittel und Rohstoffe werden teurer, der Zugang zu sauberem Trinkwasser wird erschwert, Personen...
Mit Vollgas zurück? Frauenpolitik unter Schwarz-Blau II
Dienstag | 05.03 2019 |19:00| Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien Für feministische Politik wehte bereits unter der ersten schwarz-blauen Regierung Anfang der 2000er Jahre ein rauer Wind. Die Bedeutung der Familie wurde rhetorisch gerne betont, gleichzeitig...
