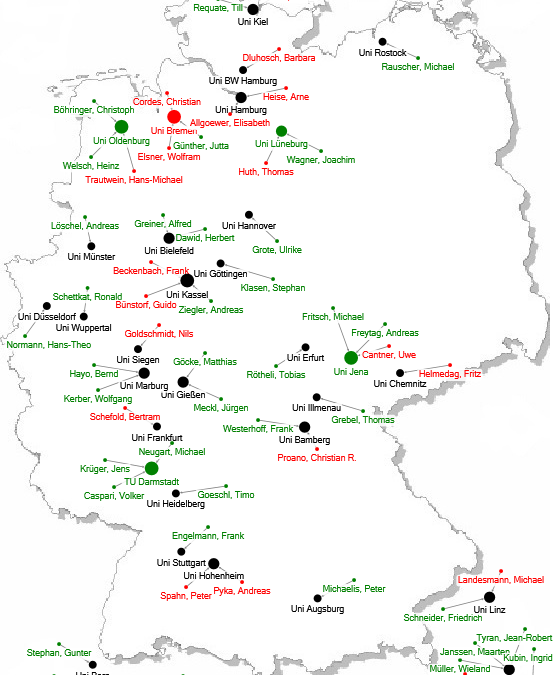Und täglich grüßt…
„Hausfrau“ und „schlanker Staat“ sind zurück Im Vorfeld der ersten Budgetrede der neuen Bundesregierung Mitte März wurde bereits gestern ein „Nulldefizit“ für 2019 angekündigt. Ziel sei „ein schlanker Staat“ – kennen wir das nicht irgendwo her? Wieder einmal wird die...EuroMemorandum 2018: Can the EU still be saved? The implications of a multi-speed Europe
Nearly ten years into the crisis, after the EU opted for austerity and deregulation, the member states are still looking for the way out. The repercussions include the rise of ultra-right wing political forces across Europe which feeds into the anti-European popular...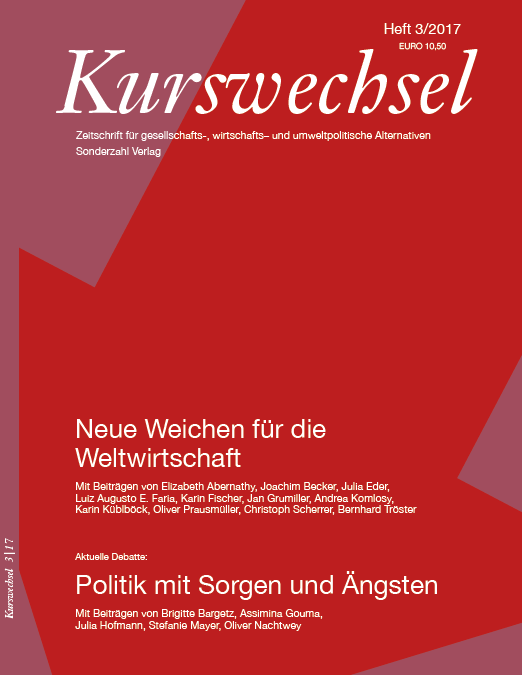
Neuer Kurswechsel: Neue Weichen für die Weltwirtschaft
Neue Weichen für die Weltwirtschaft Gleich ob der Blick in Richtung USA, EU, China, Russland oder etwa Brasilien geht: Die Zeichen stehen auf tiefgreifenden Umbruch internationaler Kräfteverhältnisse. Doch allzu pauschale Diagnosen – wie etwa „Niedergang des Nordens“,...