Budgetloch: Wie sich rechte Think Tanks in der Öffentlichkeit breit machen und die Politik in die Bredouille bringen
Die Budgetdebatte, die in letzter Zeit gelaufen ist, lässt sich so zusammenfassen: Die PolitikerInnen, getrieben von ihren Ambitionen wiedergewählt zu werden, versprechen vor der Wahl das Blaue vom Himmel und verschweigen, dass sie dies niemals einlösen werden können. Die WirtschaftsexpertInnen hingegen, darunter ‚wirklich unabhängige‘, die von Industriellen und MilliardärInnen bezahlt werden, haben schon immer gewusst, dass Geld ausgeben immer schlecht ist, und der Staat niemals sparen kann und will. Denn er wird vom ‚bösen Wähler‘ verführt noch mehr Geld auszugeben. So schreibt etwa die rechte ‚Initiative pro Marktwirtschaft‘ vor der NR-Wahl: “Aber trotz bitterer Erfahrung scheint das ‘Geschenk-Gen‘ der Politiker so ausgeprägt zu sein, dass man es auch 2013 offenbar nicht lassen kann.“ (http://www.promarktwirtschaft.at/Brief10)
Und obwohl der rechte Think Tank ‚Agenda Austria‘ keinerlei Expertise in Sachen Budgetpolitik vorweisen kann, behauptet dessen Sprecher Franz Schellhorn vor einigen Tagen, es fehlten an die 40 Mrd. Euro im Staatshaushalt (http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1476433/Budgetloch_IV-fordert-strafrechtliche-Konsequenzen).
So stellt sich also die Debatte zu den öffentlichen Finanzen in Österreich im November 2013 dar.
Finanzkrise Grund des Budgetlochs
Wir befinden uns im fünften Jahr nach Ausbruch der – vom Finanzsektor ausgegangenen – Krise, die mit enormen finanziellen Einsatz der öffentlichen Hand abgefangen werden musste und Staaten wie StaatsbürgerInnen damit hohe Kosten aufgebürdet hat. Diese Kosten haben im Vergleich zur Vorperiode zu einem extremen Anstieg der öffentlichen Verschuldung geführt.
Keineswegs sind die Budgets wegen abwegiger Wünsche der Bevölkerung aus dem Ruder gelaufen. Ganz im Gegenteil: Es wurden seit Ausbruch der Krise in Österreich zwei Sparpakete beschlossen. Der Budgetvollzug war in den letzten Jahren strikter als der Voranschlag. Was heißt: Es wurde mehr gespart, als ursprünglich veranschlagt, in den letzten beiden Jahren um je über zwei Milliarden Euro.
Und wie sieht es mit der Unvernunft der PolitikerInnen aus? Die „maßlosen“ Versprechen, die da vor den Wahlen gegeben wurden: Ausbau der Kinderbetreuung (ein Luxusproblem?) oder steuerliche Entlastung der ArbeitnehmerInnen (Österreich hat im internationalen Vergleich eine sehr hohe Belastung der Arbeitseinkommen, wie selbst der IWF kritisiert)?
Sind Anliegen der BürgerInnen, die sie an die Politik haben, in einer Demokratie verwerflich? Ja, wenn man den rechten Think Tanks glaubt, die in Österreich wie Schwammerl aus dem Boden schießen. So meint Hans Pitlik, Wirtschaftsforscher und im Beirat der weis[s]en Wirtschaft: „Dass der Staat nicht von seiner „Sucht“ nach neuen Schulden loskommt, liege auch an den Wählern, (..). Sie führten die Politiker immer wieder in Versuchung, mehr auszugeben als sie einnehmen.“ (http://oe1.orf.at/artikel/357186)
Thinks Tanks bevölkern die Medienlandschaft
Die auftretenden Experten behaupten, sie seien vernünftige Ökonomen und unabhängig, weil sie ihr Geld von der Industriellenvereinigung und anonymen SpenderInnen (darunter mutmaßlich Milliardäre) nehmen und nicht von der öffentlichen Hand.
Viele Think Tanks betreiben damit heutzutage das Geschäft der LobbyistInnen, wie neue Forschungsergebnisse( http://thinktanknetworkresearch.net/blog_ttni_en/) zeigen. Es geht nicht mehr um Wissensproduktion, sondern um ‚Meinungsmarketing‘. Nachdem Lobbyismus in Verruf geraten ist, wird nun unter dem Deckmantel einer Denkfabrik weiter gemacht. Das Ziel rechter Denkfabriken ist es, den Staat, seine Träger und Institutionen unglaubwürdig zu machen und diese ob ihrer inhärenten „Verschwendungssucht“ zu denunzieren. Ihr Programm: Entdemokratisierung durch politische Entscheidungen auf ExpertInnen-Ebene, sowie ‚Automatismen‘ statt demokratischer Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse.
Wer macht die Regeln?
Hier geht es aber gegen die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaften, wenn das „Königsrecht“ unserer gewählten Legislativorgane, die Budgethoheit des Parlaments, in Frage gestellt wird. Die zentrale Frage ist: Macht eine ökonomischen Elite und deren Interessen verbundene Expertokratie die Regeln, oder demokratisch legitimierte Institutionen? Die Hayek’sche Wirtschaftregierung schaut schon um die Ecke, wenn dem Fiskalrat und der Bürokratie der Europäischen Kommission mittlerweile das Recht eingeräumt wird, die Budgets vorab zu prüfen und Verwarnungen auszusprechen.
Klarerweise soll damit die Politik damit nicht freigesprochen werden. Es gibt ein Versagen beim Handeln, ein Untätig sein gegen diese neoliberalen, autoritären Entwicklungen. Es liegt also auch ein Selbstverschulden der Politik vor. Auch erwähnt werden sollte das Versagen der unabhängigen und freien Presse, die bei diesem Spiel mitmacht, indem sie Statements von Think Tank-Vertretern unhinterfragt übernimmt.
Wenn politische Willensbildung durch ExpertInnenmeinung ersetzt wird, bewegen wir uns hin zum geflügelten Wort: ‚Wer das Geld hat, macht die Regeln‘. Denn Lobbyismus ist nicht gratis, und die Kräfteverhältnisse sind in diesem Bereich eindeutig auf Seiten der Vermögenden. Demgegenüber steht der Grundsatz der Demokratie: ‚Jede Stimme ist gleich viel wert‘. Diesen Pluralismus der Vielen und auch die Interessen der sozial Schwächeren gilt es zu verteidigen.
Christa Schlager ist Redakteurin der Zeitschrift Kurswechsel und seit 1997 im BEIGEWUM aktiv.
Diskussionsveranstaltung “Crisis and Social Protests in South East Europe: from Slovenia to Bulgaria”
Unter der Moderation von Joachim Becker (Kurswechsel Redaktion) diskutieren
Mariya Ivancheva (Visiting Fellow am IWM, Institut für die Wissenschaften vom Menschen) und
Blaž Gselman (DPU, Workers and Punks’ University, Ljubljana)
Dienstag, 19. November, 19:30
Alois Wagner Saal
C3 – Centrum für Internationale Entwicklung
Sensengasse 3, 1090 Wien
Noch immer heißt es offiziell oft, Osteuropa sei eine „Erfolgsgeschichte“. Gemeint sind hierbei meist die Osteuropa-Geschäfte österreichischer Banken und anderer Firmen. Doch gehört Südeuropa zu den Regionen, die von der Krise besonders stark betroffen sind. Und die starke Krise war in den vermeintlichen Erfolgsmodellen mit ihrer geringen Akzentsetzung bei den produktiven Sektoren und ihrer hohen Kreditabhängigkeit gelegt worden. Die Krise hat in verschiedenen südosteuropäischen Ländern – von Slowenien bis Bulgarien – soziale Protestbewegungen ausgelöst. In Slowenien gab es starke Proteste gegen die Sparpolitik, aber auch Korruptionsskandale, in Bulgarien waren starke Preiserhöhungen ausländischer Stromkonzerne im Kontext starker Verarmung großer Teile der Bevölkerung ein erster Auslöser von Protesten. In Rumänien setzt die Regierung verstärkt auf Bergbauproduktion – und gegen ein Goldbergbauprojekt mit starken ökologischen Folgen für die Region ging jüngst ein breites Protestspektrum auf die Straßen. Die Veranstaltung geht den jeweiligen Krisenverläufen, den unterschiedlichen sozialen Protesten, ihren TrägerInnen, Anliegen, Mobilisierungsstrategien, Erfolgen und Grenzen nach.
Veranstaltung in englischer Sprache, im Anschluss wird es ein kleines Buffet geben.
6. November 2013: Präsentation Kurswechsel 2/13 – „Social Entrepreneurship als Ausweg? Facetten sozialen Engagements von Unternehmen“
Präsentation Kurswechsel 2/13
„Social Entrepreneurship als Ausweg?
Facetten sozialen Engagements von Unternehmen“
Unter der Moderation von Dominik Sinnreich (Puls 4) diskutieren
Judith Pühringer (bdv austria, Bundesdachverband für Soziale Unternehmen),
Reinhard Millner (WU Wien) und
Anita Roitner (Ökonomin und Herausgeberin des aktuellen „Kurswechsel“)
Mittwoch, 6. November 2013, 18:30 Uhr
WU Campus Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
Gebäude TC (Teaching Center, rost-orange), Raum 5.27 (5.Stock)
Im Schatten der Krise werden PolitikerInnen für ein vermeintliches Versagen des Staates verantwortlich gemacht, ihnen wird nicht zugetraut, passende Lösungen für die gegenwärtigen Probleme zu finden. Hingegen erfinden sich Unternehmen neu – mit Instrumenten wie Corporate Social Responsibility, sozialen Innovationen, oder sie verschreiben sich gleich in erster Linie einer sozialen Mission, wie die aufkommenden Social Entrepreneurs. Soll und kann die Verantwortung für gesellschaftspolitische Probleme an Unternehmen abgegeben werden? Wie ist das Phänomen der Social Entrepreneurs einzuschätzen, und welche Rolle spielt dabei die Europäische Union? Diese und weitere Fragen werden im aktuellen Kurswechsel „Social Entrepreneurship als Ausweg?“ diskutiert, und dienen als Grundlage für die Podiumsdiskussion am 6. November.
Der Kurswechsel kann hier bestellt werden.
27.11.2013: Dritte Reichtumskonferenz
Mittwoch, 27.11.2013, 9 bis 21 Uhr
AK Wien – Theresianumgasse 16–18; 1040 Wien
Die „3. Reichtumskonferenz – Wer das Gold hat, macht die Regeln“ rückt den die Gesellschaft spaltenden Reichtum in den Fokus.
Aus verschiedensten wissenschaftlichen und künstlerischen Perspektiven soll der Frage nach der Rechtfertigung von Vermögenskonzentration und sozialer Ungleichheit nachgegangen werden. Die Reichtumskonferenz wird sich philosophisch mit Gerechtigkeits- und Leistungsbegriffen auseinandersetzen, die empirische Vermögensforschung erörtern und die demokratischen Risiken von Reichtumskonzentration diskutieren.
organisiert von Arbeiterkammer Wien | Attac | BEIGEWUM | Die Armutskonferenz | Evangelische Akademie | Globale Verantwortung | Greenpeace | Katholische Sozialakademie | Österreichische HochschülerInnenschaft
Programm & Anmeldung hier
16.11.2013: Krisen-Metaphern-Workshop @ Alternative Medienakademie
Die Sprache der Krise – die Krise der Sprache
Analyse neoliberaler Metaphern
BEIGEWUM Workshop bei der Alternativen Medieanakademie in Wien
Wann: Sa, 16.11. von 14.30 bis 18.00
Wo: NIG, Inst.f.Politikwissenschaft, 2. Stock
Anmeldung: erforderlich, maximal 30 Teilnehmer_innen.
In diesem Workshop wird der Rolle von Sprach- und Bildpolitiken in der Krisenberichterstattung nachgegangen. Dafür bildet u.a. das aktuelle BEIGEWUM-Buch «Imagine Economy. Neoliberale Metaphern im wirtschaftspolitischen Diskurs» den Hintergrund. Es geht um Metaphern wie die der “Leistungsträger”, des “Exportweltmeister” oder um jene der “Schuldenbremse”, um die Analyse ihre Wirkung und die Möglichkeit der wirksamen Dekonstruktion solcher gezielt eingesetzten sprachlichen Kampfbegriffe.
10.10.2013: ALTERSSICHERUNG: Das neue alte Thema für Frauen
Donnerstag, 10. Oktober 2013, 19 Uhr, im Republikanischen Club – Neues Österreich
ALTERSSICHERUNG: Das neue alte Thema für Frauen
Diskussion mit
Margitta MÄTZKE (Prof. Soziologin Uni-Linz),
Ingrid MAIRHUBER (Politologin, FORBA),
Christine MAYRHUBER (BEIGEWUM).
Präsentation des Kurswechsel: Alter – das neue alte Risiko
Von sozialem Aufstieg und journalistischem Abstieg
Eine bürgerliche Allianz aus der Tageszeitung „Die Presse“ und der Industriellenvereinigung (IV) bestreitet die Tatsache, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Ein Unterfangen, das sich als problematisch herausstellt, denn die zitierte Auftragsstudie der Statistik Austria existiert nicht und zudem erzählen die Zahlen eine andere Geschichte. Die attestierten Aufstiegschancen österreichischer ArbeitnehmerInnen beruhen auf eingeschränktem Zahlenmaterial und stehen manifesten Abstiegsrisiken gegenüber. Die Zutaten für einen Leitartikel sind dennoch schnell gefunden: Eine Studie, die es nicht gibt, über einen Mythos, der keiner ist.
Mithilfe von Lohnsteuerdaten aus den Jahren 2000 und 2011 werden unselbständig Beschäftigte beobachtet, die sowohl zu Beginn als auch am Ende des Betrachtungszeitraums in der Statistik zu finden sind. Hier offenbart sich die erste Schwäche der Analyse, da jene Beschäftigten, die 2000 noch erwerbstätig aber 2011 in Arbeitslosigkeit, Pension, Karenz oder einfach nicht mehr beschäftigt waren, nicht beachtet werden. Nur weniger als die Hälfte der in einem dieser Jahre unselbständigen Erwerbstätigen wird also überhaupt berücksichtigt. Während die Presse festhält, dass „der Anteil der verfestigten Armut hierzulande sehr gering“ sei, findet die Armutsfalle Arbeitslosigkeit überhaupt keine Erwähnung.
Aber nicht nur am unteren Ende wird ein Teil der Gesellschaft bei der Analyse von Mobilität ausgeblendet. Die Reichsten werden ebenfalls ignoriert, denn sie gehören nicht zur lohnsteuerpflichtigen Bevölkerung. Die wirklich begüterten österreichischen Haushalte beziehen ihre Einkommen aus Vermögen und das ist hierzulande äußerst ungleich verteilt. In Österreich besitzen die unteren 50% lediglich 4% des Nettovermögens, während die reichsten 5% etwa 45% unter sich aufteilen.
Nahezu gleich schlecht ist noch kein Aufstieg
Auch wenn man von den gravierenden Einschränkungen durch die beschnittenen Daten absieht, bleibt die Interpretation der IV äußerst morsch. Plakativ wird dargestellt, dass drei Viertel der unselbständig Beschäftigten aus dem untersten Zehntel (Dezil) den Absprung aus dem ärmsten Einkommenssegment schaffen. Dass die meisten allerdings nur ein oder zwei Dezilsgrenzen überschreiten, wird verschwiegen. Mehr als die Hälfte des untersten Zehntels aus dem Jahr 2000 fand sich 11 Jahre später in einem der ärmsten drei Dezile und verdient monatlich weniger als 1.000 Euro brutto. Was also in den unteren Einkommensbereichen als „Aufwärtsmobilität“ und „Aufstiegschance“ bezeichnet wird, spielt sich in einem sehr tristen Einkommensbereich ab. Einen weiteren Teil der Aufwärtsmobilität steuern BerufseinsteigerInnen bei. Dass Beschäftigte nach zehn Jahren mehr verdienen als bei ihrem Eintritt ins Berufsleben, ist zum Glück nicht verwunderlich.
Aus den Daten der Statistik Austria lassen sich die Zahlenspiele der IV rasch entzaubern. Zweifellos ist es erfreulich, dass rund 32% der Lohnabhängigen zwischen 2000 und 2011 ihre Position innerhalb der Einkommensverteilung verbessern konnten – wenn auch wie erwähnt oft nur geringfügig. Demgegenüber stehen allerdings 40% der ArbeitnehmerInnen, die in diesem Zeitraum in ein niedrigeres Dezil abgestiegen sind. Eine Einkommensgruppe konnte ihre Position indessen am besten verteidigen: Die obersten 10%. Nahezu zwei Drittel gehörten sowohl im Jahr 2000 als auch 2011 dieser Gruppe an.
Die Einkommensschere geht sehr wohl auf
Trotz aller Widersprüche in der Analyse lassen sich Presse und IV nicht beirren: „Die Einkommensschere geht in Österreich nicht auf“ lautet das Resümee. Ein kurzer Blick in den Sozialbericht 2010 genügt, um für die Lohnsteuerdaten das genaue Gegenteil festzustellen. Unter Berücksichtigung aller ArbeitnehmerInnen wies das unterste Fünftel im Jahr 2000 einen Einkommensanteil von 2,5% auf, welcher bis 2010 auf 2,0% schrumpfte. Am oberen Ende konnte das reichste Fünftel seinen Einkommensanteil indessen von 45,7 auf 47,4% steigern. Im selben Zeitraum berechnen die StudienautorInnen eine deutliche Zunahme des Gini-Koeffizienten, was auf eine zunehmende Einkommensungleichheit hinweist (siehe Tabelle).
Entwicklung der Verteilung der lohnsteuerpflichtigen Einkommen, 1976–2010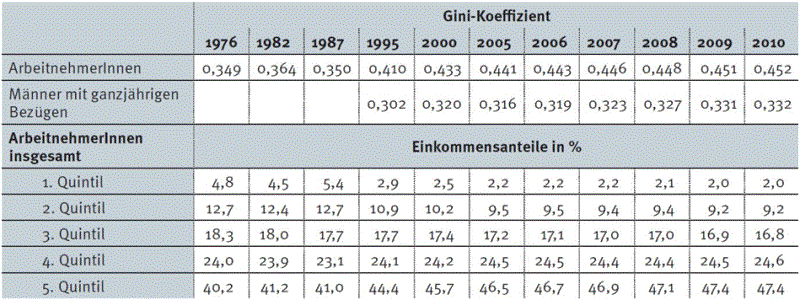 Quelle: Sozialbericht 2011-12, S. 233
Quelle: Sozialbericht 2011-12, S. 233
Soziale Mobilität muss gestärkt werden
Soziale Mobilität stellt einen wichtigen Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie für das individuelle Gerechtigkeitsempfinden dar. Dies gilt sowohl für die Positionierung in der Einkommensverteilung im Laufe einer Erwerbskarriere als auch für die intergenerationale Mobilität, welche den Einfluss der Einkommen von Eltern auf den Bildungs- und Erwerbsverlauf ihrer Kinder misst. Hieraus leiten sich auch die wichtigsten Maßnahmen für Chancengleichheit in Österreich ab, die das schiefe Spielfeld ebnen sollen.
Für die Aufstiegschancen innerhalb eines Erwerbslebens spielt Bildung die zentrale Rolle, was die Notwendigkeit von vorschulischen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Gesamtschulen sowie des freien Hochschulzugangs unterstreicht. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung („working poor“) ist essentiell, um Wege aus der Armutsfalle zu bieten (12,6% der Bevölkerung waren 2011 armutsgefährdet). Nicht zuletzt muss aber endlich dort angesetzt werden, wo leistungsloses Einkommen aus extrem ungleich verteilten Ressourcen bezogen wird: aus den Privatvermögen. Eine Vermögenssteuer soll gemeinsam mit der Wiedereinführung der Erbschaftssteuer für die Mittel zur Umverteilung ökonomischer Ressourcen sorgen.
Matthias Schnetzer ist Referent für Verteilungsfragen sowie Sozial- und Wirtschaftsstatistik in der AK Wien.
26.6.2013, 19h: Buchpräsentation „Mythen des Sparens“
Einladung zur Buchpräsentation
Mittwoch, 26. Juni 2013, 19 Uhr
Republikanischer Club, Rockhgasse 1, 1010 Wien
Aus dem AutorInnenkollektiv präsentieren und diskutieren
Jana Schultheiss (stv. Vorsitzende des BEIGEWUM)
Lukas Oberndorfer (Mitinitiator des Aufrufs „Europa geht anders“; Redaktionsmitglied des juridikum – zeitschrift für kritik|recht|gesellschaft)
Tobias Orischnig (BEIGEWUM)
Neues BEIGEWUM-Buch: Mythen des Sparens
Antizyklische Alternativen zur Schuldenbremse
 Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist längst zu einer Verschuldungskrise der Staaten geworden, zumindest wenn man den Mainstream-Medien und der Mehrzahl der Politikerinnen und Politiker Glauben schenkt: Sparen sei das Gebot der Stunde, an dem kein Ausweg vorbei zu führen scheint. Grund genug für ein neuerliches Buchprojekt als „Fortsetzung“ unseres 2010 erschienen Buchs „Mythen der Krise“.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist längst zu einer Verschuldungskrise der Staaten geworden, zumindest wenn man den Mainstream-Medien und der Mehrzahl der Politikerinnen und Politiker Glauben schenkt: Sparen sei das Gebot der Stunde, an dem kein Ausweg vorbei zu führen scheint. Grund genug für ein neuerliches Buchprojekt als „Fortsetzung“ unseres 2010 erschienen Buchs „Mythen der Krise“.
Mit unserem neuesten Buch wollen wir aufzeigen, dass es sich hierbei nur um einen weiteren wirtschaftspolitischen Mythos handelt. Doch warum kommen diese Mythen so gut bei den Menschen an? Und welche Auswirkungen haben die Sparmaßnahmen auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und sogar auf die Demokratie?
Dargestellt werden die wichtigsten Mythen zu »Schulden« und »Sparen«. Diese werden kritisch hinterfragt und die dahinterstehenden ökonomischen Zusammenhänge erklärt. Auch die Ebene der EU-Politik und der dort kursierenden Mythen kommt nicht zu kurz.
Leseprobe, weiterführende Infos und Bestellmöglichkeit gibt es direkt beim VSA-Verlag – oder bei einer unserer kommenden Veranstaltungen.
10.6.2013: Über Österreich, Deutschland und Europa. Vor der Wahl ist nach der Wahl.
Podiumsdiskussion „Über Österreich, Deutschland und Europa. Vor der Wahl ist nach der Wahl.“
Mo., 10. Juni, 18:30 in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags (Rathausstraße 21, 1010 Wien) oder online.
Diskussion mit Jana Schultheiss (BEIGEWUM/Buchprojekt „Mythen des Sparens“), Wolfgang Lieb (NachDenkSeiten), Markus Marterbauer (AK Wien/Blog Arbeit&Wirtschaft); Moderation: Katharina Klee (Zeitschrift Arbeit&Wirtschaft)
Anmeldung: veranstaltung@oegbverlag.at oder auf Facebook
Im Herbst 2013 finden Nationalratswahlen in Österreich und die Bundestagswahl in Deutschland statt, im Mai 2014 dann auch die Europawahl. Sowohl Deutschland als auch Österreich sind im Vergleich mit den meisten anderen EU ‑Ländern gut durch die Krise gekommen. Gleichzeitig meinen viele, die beiden Länder hätten weniger zur Lösung der Krise beigetragen als sie wirtschaftlich könnten und man politisch von ihnen erhoffen würde. Deutschland verschärft durch seine Vorgaben sogar den Austeritätskurs, die Wettbewerbsorientierung und die neoliberale Ausrichtung der EU ‑Strategie und auch Österreich muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht viel dagegen zu tun. Wo aber sind die tatsächlichen Spielräume für eine alternative, emanzipatorische Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in der EU?
Eine Veranstaltung der „Arbeit&Wirtschaft“ in Kooperation mit den NachDenkSeiten, dem ÖGB-Verlag und dem BEIGEWUM … mit anschließendem Buffet.