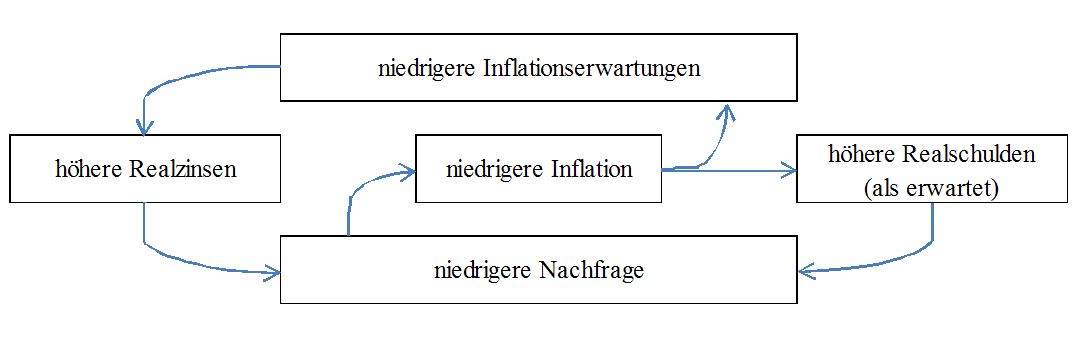„Economics of Inequality“
Am nächsten Wochenende (30./31.5.2014) findet an der WU Wien die Jahreskonferenz der Nationalökonomischen Gesellschaft (NOeG) zum Thema „Economics of Inequality“ statt. Die drei Plenarveranstaltungen sind frei zugängig für alle; das gesamte wissenschaftliche Programm...Feministische Perspektiven auf die Ökonomie und ihre Krisen. Buch- und Kurswechsel-Präsentation Feministische Ökonomie
Zeit: Mittwoch, 11. Juni 2014, 19.00 Uhr Ort: TC.0.01 (Teaching Center), Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien Mit: Bettina Haidinger, Käthe Knittler, Katharina Mader und Christa Schlager Moderation: Alyssa Schneebaum Die herrschende...Europa spaltet sich. Die Notwendigkeit für radikale Alternativen zur gegenwärtigen EU-Politik. Präsentation des EuroMemorandum 2014
Donnerstag, 22. Mai 2014, 18.00 – 20.00 Uhr, C3-Centrum für Internationale Entwicklung, Sensengasse 3, 1090 Wien Programm: Eröffnung: Jana Schultheiss, BEIGEWUM Präsentation des EuroMemorandums 2014: „Europa spaltet sich. Die Notwendigkeit für radikale Alternativen...