Deutschland – Totengräber der Währungsunion?
Die Weigerung der deutschen Bundesregierung, Griechenland in der sich seit Monaten zuspitzenden Schuldenkrise unter die Arme zu greifen, hat die griechische Krise zu einer europäischen Krise werden lassen. Mehr noch, mittlerweile steht die Zukunft der Währungsunion auf dem Spiel. Darüber entscheiden wird maßgeblich das Verhalten der deutschen Politik.
Das vor allem in Deutschland – aber auch in Österreich – verbreitete Griechenland-Bashing und das kaum verhohlene Wiederaufleben anti-griechischer Ressentiments, ist nicht nur ökonomisch gefährlich, sondern wird die kulturelle Kluft zwischen den Mitgliedsstaaten der EU vertiefen und damit die Fundamente einer weitergehenden politischen Integration aushöhlen. Wer am Projekt Europa festhalten will, sollte gerade in der Krise nicht populistischen Verkürzungen erliegen, sondern eine ausgewogene Ursachenforschung betreiben. Das bedeutet zum ersten, anzuerkennen, dass es hausgemachte Fehler der griechischen Wirtschaftspolitik der letzten 10 Jahre gegeben hat – so war das Budgetdefizit vor Ausbruch der Krise bei hohen 5%. Die derzeitige Höhe des Defizits (13%) ist aber maßgeblich auf den Ausbruch der globalen Finanzkrise zurückführen. Es kann nicht als Versagen des griechischen Staats gelten. Die Griechen sind auch entgegen vorherrschender Vorurteile nicht faul. Das Produktivitätswachstum Griechenland überstieg das deutsche um das Doppelte seit Einführung des Euro im Jahr 1999. Die Griechen sind auch das Volk mit der längsten jährlichen Arbeitszeit in Europa.
Zum Zweiten muss man ganz klar sagen, dass Deutschland selbst eine Geschichte als Budgetsünder hat. So wurde in den Jahren 2001–2005 das Defizitkriterium des Stabilitätspakts regelmäßig verletzt. Auf maßgebliches Drängen der deutschen Regierung ist es 2005 zu einer Aufweichung des Stabilitätspakts gekommen. Übrigens ist die deutsche Bundesregierung damals kläglich mit dem Versuch gescheitert, sein Budget durch Sparprogramme zu sanieren. Genau das wird jetzt aber von Griechenland verlangt. Die Regierung Merkel misst also mit zweierlei Maß, wenn es jetzt Griechenland und anderen EU-Staaten brutale Sparprogramme aufzwingen will.
Drittens hätte es gar nicht soweit mit Griechenland kommen müssen. Die regelrechte Verzögerungstaktik der Bundesregierung während der letzten Monate bei der Ausarbeitung des Hilfspakets hat zu einer massiven Verunsicherung auf den Finanzmärkten geführt und Spekulanten auf den Plan gerufen, die auf einen Staatsbankrott Griechenlands gewettet haben. Daher das Explodieren der Risikoaufschläge auf griechische Staatsanleihen der letzten Wochen. Bei einer raschen Rettungsaktion wäre eine solche Dynamik erst gar nicht entstanden.
Viertens verstellt der herrschende wirtschaftspolitische Diskurs in Deutschland den Blick auf die ökonomischen Funktionsbedingungen einer Währungsunion. Der erste Grundsatz lautet, dass die makroökonomische Stabilität einer Währungsunion nur dann gewährleistet werden kann, wenn es zu einer realen Konvergenz von Preisen und Löhnen kommt. Hierbei spielt die Lohnpolitik eine zentrale Rolle. Nur wenn die Lohnabschlüsse in den Mitgliedsstaaten sich an der Zielinflationsrate der EZB und dem nationalen Produktivitätswachstum orientieren, kann verhindert werden, dass es zu einer Auseinanderentwicklung der Lohnstückkosten kommt. Gelingt dies nicht, kommt es unweigerlich zu Veränderungen der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Exportindustrien, die dann wiederum zu steigenden Handelsbilanzungleichgewichten führen. Genau das ist in der Währungsunion passiert. Länder wie Griechenland hatten in den letzten 10 Jahren zu hohe Lohnabschlüsse mit dementsprechend negativen Effekten auf ihren Handelsbilanzsaldo (-14% 2008). In Ländern mit unterdurchschnittlichen Lohnabschlüssen, allen voran Deutschland, kam es zu einem regelrechten Exportboom mit hohen Außenhandelsüberschüssen. Das heißt, beide Seiten haben gegen die Regeln verstoßen, die einen mit zu hohen Lohnabschlüssen, die anderen mit zu niedrigen. Wenn kleine Länder wie Österreich über Exporte wachsen wollen, mag das noch verkraftbar sein. Wenn das aber die Wachstumsstrategie der größten Volkswirtschaft der EU ist, muss dies zu massiven außenwirtschaftlichen Verwerfungen führen. In einer Währungsunion fällt aber das wirtschaftspolitische Mittel der Wahl zum Abbau von Handelsbilanzungleichgewichten, nämlich eine Währungsabwertung, weg. Der Abbau des Ungleichgewichts geht nur über eine reale Ab- bzw. Aufwertung. Mit anderen Worten: Griechenland muss seine Preise und Löhne senken, Deutschland diese erhöhen. Der derzeitige Lösungsansatz von EU und IWF konzentriert sich allerdings einseitig auf ersteres, zweiteres wird ignoriert. Schlimmer noch: das deutsche Establishment weigert sich beharrlich, seinen Teil der Verantwortung an der Krise anzuerkennen und die notwendigen strukturellen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Im Gegenteil: am Dogma, dass die Erhöhung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch niedrige Lohnabschlüsse immer und überall die richtige wirtschaftspolitische Strategie darstellt, wird hartnäckig festgehalten.
Das in der Diskussion strapazierte moralische Argument, kein Land dürfe über seine Verhältnisse leben und mehr Schulden aufnehmen als es zurückzahlen kann (und müsse daher bei Zahlungsunfähigkeit durch strenge Sparauflagen bestraft werden), sieht nicht nur von der moralischen Verantwortung des Gläubigers ab, sondern zeugt von ökonomischem Masochismus und politischer Kurzsichtigkeit. Wenn Griechenland – und in weiterer Folge andere von Schuldenkrisen bedrohte Länder wie Portugal, Spanien oder Irland, jetzt auf Jahre zu strenger Sparpolitik gezwungen werden, leidet zuallererst die größte europäische Exportnation, indem für deutsche Exportprodukte Absatzmärkte weg brechen. Zum zweiten wird damit jede Wachstumsdynamik in den Schuldnerländern abgewürgt, und in Folge dessen die Fähigkeit zur Rückzahlung der Schulden erst recht wieder in Frage gestellt. Zahlreiche Schuldenkrisen der jüngeren Geschichte haben gezeigt, dass ein Land sich aus seinen Schulden nicht heraussparen, sondern nur herauswachsen kann. Entscheidend für die Zahlungsfähigkeit Griechenlands wird daher sein, dass es rasch auf einen Wachstumspfad zurückkehren kann. Dafür braucht es kurzfristig Überbrückungskredite von EU und IWF sowie eine Umschuldung mit einer substanziellen Reduktion der Schuldenlast zulasten der Gläubiger griechischer Staatsanleihen. Darüber hinaus muss es aber eine partielle Rücknahme bzw. zeitliche Streckung der überzogen strengen Sparauflagen geben. Nur so kann Griechenland in die Lage versetzt werden, Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft zu tätigen und die schlimmsten sozialen Auswirkungen der Krise auf seine Bevölkerung abzumildern. Wer in Deutschland und anderswo daran interessiert ist, dass das europäische Projekt eine politische Zukunft hat, sollte gerade den letzten Punkt nicht aus den Augen verlieren.
Und das Ziel der Sache?
Im Blog der Zeitschrift „The Economist“:
What exactly was the purpose of the financial sector supposed to be, again? Because I‘m pretty sure „inflating bubbles so as to bet on their collapse, thus forcing the taxpayers to bail out your counterparties“ wasn’t it. [link]
Es geht natürlich um die Anklage der U.S.-amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC gegen die Investmentbank Goldman Sachs. Die Empörung schwappt über; selbst wenn die juristische Frage der Anklage noch bei weitem nicht geklärt ist, politisch scheint es sich für die Obama-Administration schon jetzt auszuzahlen.
Zeitgleich zur Goldman Sachs-Story ist am Wochenende eine einstündige Sendung auf „This American Life“ gelaufen, die – zeitlich beschränkt – auch als podcast zur Verfügung steht, und in der ein ähnliches Vorgehen, wie es Goldman Sachs vorgeworfen wird, beim Chicagoer Hedgefund Magnetar diagnostiziert wird. Die Geschichte wurde zuerst von Journalisten auf propublica publiziert und ist sehr lesenswert; unter anderem, weil das systematische Vorgehen sehr deutlich wird:
Deutsche, Magnetar and State Street called the $1.6 billion CDO they created Carina, a constellation whose name in Latin means a ship’s keel. In November 2007, Carina had the distinction of being the first subprime CDO of its kind to be forced into liquidation. [link]
Die Sache bleibt aus mehreren Gründen interessant. Kann die SEC, die in den letzten Jahren stark kritisiert wurde (man denke nur an Madoff), mit einem aufsehenerregenden Fall wie gegen Goldman Sachs ihre Reputation wieder herstellen? Kann die Regierung Obama die umstrittene Finanzmarktregulierung durch den Kongress bringen? Und wie werden sich die Banken wehren?
Die Logik des Exportweltmeisters
In Deutschland ist man irrsinnig stolz darauf, dass Deutschland so viel exportiert und wenig importiert. Eine ähnliche Politik fährt auch Österreich. Das Problem an der Sache: Wenn ein Land Exportüberschüsse hat, dann braucht ein anderes Importüberschüsse, denn in Summe aller Länder der Welt müssen sich Exporte und Importe immer zu Null addieren. Mit anderen Worten: Das Importland verschuldet sich beim Exportland. Noch anders: Zahlreiche Länder der EU (und darüber hinaus) sind bei Deutschland verschuldet. Nun fordert die veröffentlichte Meinung in Deutschland, die Schuldenländer sollten mal weniger Schulden machen, gleichzeitig wird von Bundeswirtschaftsminister Brüderle (FDP) eine Außenwirtschaftsoffensive angekündigt, um die Exporte zu stärken. Das nenne ich Logik: Die anderen sollen sparen, mehr Überschüsse erwirtschaften und mehr deutsche Waren kaufen. Wie das gehen soll, bleibt dabei unerklärt. Ohne dauerhaft ausgeglichene Bilanzen wird es keine Stabilität geben. Und ohne höhere Löhne in Deutschland (=Binnennachfrage stärken) wird es keine Verteilung des erwirtschafteten Wohlstands geben. Oberlehrerhaftes Getue ist weder angebracht noch hilfreich. Mehr Importe oder weniger Exporte, in jedem Fall eine stärkere Binnennachfrage, das wäre ein strategisch sinnvolles Ziel für die Bundesrepublik.
Siehe auch den FTD-Beitrag von Heiner Flassbeck und Friedericke Spiecker PDF.
Budgetpolitik mit dem Rasenmäher
Die österreichische Regierung hat sich auf einen harten Sparkurs für die kommenden Jahre geeinigt. Was sich im Jänner bereits angedeutet hatte, wurde mit den veröffentlichten Eckpunkten des Bundesfinanzrahmengesetz 2011–2014 konkret: 2011 sollen die Kosten der Krise an die Bevölkerung weitergegeben werden, nachdem sie bisher weitgehend mit staatlichen Mitteln abgefangen wurden. Die Eckpunkten enthalten drei Überraschungen: Erstens ist das Ausmaß der Konsolidierung mit bis zu 4,2 Mrd Euro (mit rund 1,5 % des BIP mehr als das Budget für Universitäten; ohne den eher unwahrscheinlichen Kürzungen von 0,8 Mrd Euro auf Landesebene immer noch 1,2 %) doppelt so hoch wie die europäischen Vorgaben (0,75 % des BIP) erfordern würden. Zweitens wird kein Bereich verschont. Mit der „Rasenmähermethode“ werden die Obergrenzen aller Ausgabenbereiche gegenüber dem BFRG 2010–2013 gekürzt, lediglich die prozentuale „Schnitthöhe“ variiert. Da die Sozialausgaben den größten Anteil im Bundesbudget ausmachen, fällt der größte Betrag (900 Mio Euro) mit dieser Methode zwangsläufig hier an. Drittens konnte die SPÖ der ÖVP abringen, dass de facto die Hälfte des Konsolidierungsvolumens durch neue oder höhere Steuern aufgebracht wird. Noch tiefere Einschnitte im Bildungs- und Sozialbereich konnten damit zwar verhindert werden – angesichts der bevorstehenden Kürzungen und drohender Massensteuern ist das Gesamtpaket trotzdem inakzeptabel. Die Krisenkosten werden auf die breite Masse der Bevölkerung verteilt, obwohl diese die Krise weder verursacht noch vom finanzgetriebenen Wirtschaftswachstum zuvor profitiert hat.
Bankensteuer als Pyrrhussieg?
Während bei der ÖVP relativ klar war, dass wider makrookönomischer Vernunft und sozialen Überlegungen ein radikaler Sparkurs auf Kosten der Allgemeinheit am Programm stand, deutete zumindest die Rhetorik des sozialdemokratischen Regierungspartners einen alternativen Kurs an. Mit der – gegen heftigen Widerstand von ÖVP und Bankenlobby – durchgesetzten Bankensteuer erreichte die SPÖ auch einen ersten konkreten Meilenstein auf dem Weg zu einer sozialeren Budgetpolitik. Wenn das jedoch der einzige Erfolg war, wird die Bankensteuer zum Pyrrhussieg, dem wertmäßig ein Mehrfaches an Massensteuern auf der Einnahmenseite und hauptsächlich Sozialausgabenkürzungen auf der Ausgabenseite gegenüberstehen. Die Bankensteuer wäre dann nicht mehr als ein Feigenblatt für ein Belastungspaket, das untere und mittlere Einkommen am stärksten treffen und gesellschaftlich sinnvolle Reformen (Kinderbetreuung, Bildung, Pflege, Integration, etc) frühestens auf 2015 verschieben würde.
„keine Tabus“
Die Ankündigung des Finanzministers, dass es beim Sparen „keine Tabus geben“ dürfe, muss als ernst zu nehmende Drohung verstanden werden. Es ist überraschend bis skandalös, dass hier sozialdemokratische MinisterInnen bisher jeglichen Widerspruch schuldig bleiben und der Kanzler diese Linie sogar aktiv befürwortet. Die Liste der aufzulistenden Tabus wäre lang und reicht von den immer noch unterdotierten Unis und Schulen über die Arbeitsmarktpolitik bis hin zum grundsätzlichen Erhalt eines leistungsfähigen Sozialstaates.
Traurige Realität ist stattdessen, dass mehr als die Hälfte der Kürzungen auf Sozialausgaben entfallen werden. Selbst die Arbeitsmarktausgaben werden trotz nicht absehbarem Rückgang der Rekordarbeitslosigkeit und trotz des Mehrbedarfs der (hoffentlich bald tatsächlich) umgesetzten Mindestsicherung relativ zum bisherigen Ausgabenplan 2011 gekürzt. Dass Sozial- und Bildungsbereich prozentual betrachtet weniger stark unter den Rasenmäher kommen ist höchstens für die PR-Verantwortlichen der Regierungsparteien ein Trost. Bitter wird es, wenn ein sozialdemokratischer Sozialminister diese Zahlen als „tragfähigen politischen Kompromiss“ verteidigt. Die konkreten Maßnahmen sind noch offen, d.h. es kann gehofft werden, dass sich wenigstens innerhalb des prekären Ausgabenrahmens bzw. bei den Mehreinnahmen die Regierungsschlagwörter „Soziale Verträglichkeit, ökonomische Vernunft, gerecht“ zeigen werden.
Regierung als Sparstreberin auf Kosten der Konjunktur
So oder so schießt die Regierung weit über das noch im Jänner angekündigte – damals noch von Pröll als „Mammutaufgabe“ bezeichnete – Ziel von ca 2,1 Mrd Euro hinaus. Im Gegensatz zu Griechenland erfolgte das übereifrig deutlich über den EU-Vorgaben liegende Konsolidierungsvorhaben freiwillig: keine Spekulationsattacken; mildere EU-Vorgaben im laufenden Defizitverfahren; sinkende Zinsaufschläge in den letzten Monaten; im internationalen Vergleich unterdurchschnittliche Neu- und Gesamtverschuldung; keine weit besseren Wirtschaftsprognosen, die eine Rückführung der Defizite eher erlauben würden; usw.
Die Begründung des Finanzministers, „dass gespart wird, um nachhaltig in die Zukunft zu investieren“, zeigt die Grenzen seiner Bauernschläue auf, wenn es um volkswirtschaftliche Zusammenhänge geht. Natürlich dämpft ein Sparpaket in dieser Größenordnung die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, sei es durch geringere verfügbare Ausgaben der privaten Haushalte (z.B. durch Pensions- und Beamtengehaltseinsparungen) oder direkt durch geringere staatliche Investitionen bzw. Konsum.
Diese geringeren Absatzaussichten werden die Unternehmensinvestitionen nicht gerade beflügeln. Die Folgen werden – verglichen mit dem Szenario „kein Sparpaket“ – eine höhere Arbeitslosigkeit und ein geringeres Wohlstandsniveau aller sein. Schätzungen von OECD, IWF oder WIFO ergeben, dass ein Sparpaket von 1 % des BIP die Wirtschaftsleistung um 0,3 bis 0,5 % dämpft. Grob geschätzt könnte das wiederum bis zu 10.000 Arbeitsplätze kosten. Niedrigere Ausgaben für Bildung, Forschung und Infrastrukturinvestitionen könnten langfristig zusätzliche Schäden verursachen.
Alternative Konsolidierungsstrategie
Führen wir uns noch einmal die Ausgangslage vor Augen: eine internationale Wirtschaftskrise, deren Ursachen u.a. mit ungleichere Einkommensverteilung, neoliberaler Umbau wohlfahrtsstaatlicher Arrangements, liberalisierten Finanzmärkten, Lohndruck durch wachsende Arbeitslosigkeit beschlagwortet werden können, wird durch massive Rettungspakete für Banken und kleineren Maßnahmen für die Konjunkturbelebung abgefedert. Zusätzlich stabilisieren die automatisch höheren Staatsausgaben (vor allem durch steigende Arbeitslosengelder und Beitragsausfällen in der Sozialversicherung) die private Nachfrage. Monate vergehen, in denen weder systematische Mängel behoben noch die Profiteure vor und in der Krise in die finanzielle Verantwortung genommen werden, obwohl beides breite Teile der Bevölkerung weltweit immer wieder einfordern, und obwohl das auch eine wirtschaftspolitisch sinnvolle Antwort wäre.
Daran anzuknüpfen, wäre das Gebot der Stunde. Die Steuervorschläge von SPÖ, Grünen, Teilen der Wissenschaft und anderen politischen Akteuren gehen in eine richtige Richtung: Finanztransaktions‑, Spekulations‑, und andere vermögensbezogene Steuern können nicht nur zu mehr Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch zu einer nachhaltigen Reduktion des Defizits/Konsolidierung des Staatshaushalts beitragen. Der falsche Weg ist es hingegen, Ausgaben mit einer abgestuften Rasenmähermethode in Zeiten von Krise und Rekordarbeitslosigkeit zu kürzen.
Trivia
Alltagsweisheiten oder, was wir schon vor einem Jahr gewusst haben (und dieser Tage trotzdem für Schlagzeilen sorgt):
Dass Pres. Obama die ökonomischen Probleme seines Landes nicht richtig angeht (siehe meinen Kurswechsel-Beitrag von 2009 hier)
Dass in Zeiten der Krise Planwirtschaft innovativer ist als Free Market Liberalism;
Dass Nostalgie eine Emotion ist, die gar wunderliche Dinge hervorbringt.
Griechenland und die Kontrastfälle der Krise in der EU
Die aktuelle Wirtschaftskrise zeigt in Europa unterschiedliche Verläufe. Manche Länder sind primär durch das Platzen von Finanz- und Immobilienblasen getroffen, andere durch den Einbruch der Exporte. Beide Formen der Krisenbetroffenheit sind in Osteuropa aufgetreten, wo einerseits Polen 2009 noch ein leichtes Wachstum verzeichnete, während in den Baltischen Ländern die Wirtschaft am stärksten schrumpfte. Ein konzertiertes Vorgehen der Europäischen Union gegen die Krise gibt es nicht. Vielmehr unterscheiden sich die Anti-Krisen-Politiken in den europäischen Zentrums- und Peripherieländern deutlich. Damit vertieft die Wirtschaftskrise die sozioökonomischen Unterschiede in der EU wie in Europa insgesamt. Sie führt auch zu einer Krise des europäischen Integrationsprozesses.
Krisenprozesse in Osteuropa
Die Akkumulation in Osteuropa war eng an die westeuropäische gekoppelt. Mit Ausnahme Sloweniens kamen die wirtschaftlichen Schlüsselsektoren in den letzten zwei Jahrzehnten unter die Kontrolle westeuropäischer Unternehmen. Allerdings unterscheiden sich die osteuropäischen Länder in der Art der Eingliederung ihrer Ökonomien in die europäische Arbeitsteilung: Bei den Visegrád-Ländern (Polen, Slowakei,Tschechische Republik – mit deutlichen Einschränkungen Ungarn) sowie Slowenien herrschte die Orientierung auf den Industriegüterexport vor. In den Baltischen Ländern und Südosteuropa war hingegen das Wachstum stark von Krediten getrieben, die einen Immobilienboom aufbliesen (vgl. Becker 2008). In dieser zweiten Ländergruppe war auch die Verschuldung der privaten Haushalte überwiegend in Fremdwährung. Im Fall einer Währungsabwertung drohte diesen Schuldnern, aber auch den dort engagierten Banken absehbar eine Finanzklemme. In Form wie Ausmaß unterschieden sich die Krisenprozesse in diesen beiden Ländergruppen deutlich. Während bei den exportorientierten Ländern der Einbruch der Exporte die Hauptrolle spielte, brachte bei den Ländern, in denen das Wachstum kreditgetrieben war, das Austrocknen der Finanzflüsse das Wirtschaftsmodell zum Einsturz. Die Rezession war in dieser Ländergruppe besonders tief und anhaltend (Workie et al 2009: 88 ff.). Im Fall der exportorientierten Ökonomien schlug der Rückgang der Exporte voll durch. So gingen die Exporte Ende 2008/Anfang 2009 um 10% und mehr gegenüber den Vorjahresquartalen zurück und waren damit Hauptfaktor der Rezession (Eurostat 2010: Tab. T1). In den Baltischen Ländern setzte die Rezession bereits Anfang 2008 ein und erreichte 2009 europäische Rekordwerte. In Lettland lagen die Rückgänge de BIP im Verlauf der vier Quartale 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 19%, in Estland, bis auf das 4. Quartal, bei über 15% und schwankten bei Litauen zwischen 13,0% und 19,7%. In Bulgarien und Rumänien setzte die Rezession später ein, vertiefte sich dafür aber während des Jahres 2009 (Eurostat 2010). In diesen Ländern, aber auch in Ungarn, gingen zwar auch die Exporte ähnlich drastisch zurück wie in den exportorientierten Ökonomien, sie wurden jedoch vor allem von den Kreditrestriktionen und Kapitalabflüssen schwer getroffen. Als das Treibmittel Kapitalimport ausfiel brachen ihre Wachstumsmodelle zusammen, speziell in den besonders hoch verschuldeten und extreme Leistungsbilanzdefizite aufweisenden Baltischen Staaten. Hier waren auch sehr starke Rückgänge im privaten Konsum zu verzeichnen.
Wirtschaftspolitische Reaktionen auf die Krise
Das Vertragswerk der EU geht implizit von der Prämisse aus, dass es keine Wirtschaftskrisen gibt. Dementsprechend fehlen auch institutionelle Vorkehrungen. Wurde die Bankenstützung mit ihren enormen Summen im Schnellverfahren durchgesetzt, so waren fiskalische Stimulierungsmaßnahmen Gegenstand heftiger Kontroversen und eher bescheiden dimensioniert. Auf die eher peripheren europäischen Länder mit traditionell hohen Leistungsbilanzdefiziten wird überdies zunehmend Druck ausgeübt, eine pro-zyklische Politik zu betreiben. Das gilt sowohl für süd- als auch für osteuropäische Staaten. Hierbei kommt der Druck von verschiedenen Seiten – der Europäischen Kommission, den FinanzanlegerInnen und Rating Agenturen sowie – im Fall Osteuropas – dem Internationalen Währungsfonds (IWF). In den Baltischen Ländern und Südosteuropa ist die Politik noch schärfer pro-zyklisch ausgerichtet als in den mediterranen Ländern. Die Muster der Politik wurden hier durch Programme des IWF in Ungarn, Lettland und Rumänien, gesetzt, die mit der Europäischen Kommission abgestimmt waren (Becker 2009, Galgóczi 2009). Diese Programme unterscheiden sich von traditionellen IWF Programmen nur in einem Punkt – der IWF will nicht dem Abzug von Geld durch die Banken den Rücken decken, sondern die Banken, angesichts deren totaler Dominanz in den osteuropäischen Bankensektoren und dem erklärtem Wunsch ihre Präsenz fortzusetzen, im Lande halten. Das oberste Ziel ist, die Währungsparitäten zu halten. Dies entspricht den Interessen der westeuropäischen Banken und GeldbesitzerInnen, für die Währungsabwertungen Entwertungen ihrer Aktiva bedeuteten. Diese Ausrichtung entspricht aber auch den Vorstellungen der Schuldner bei Devisenkrediten, deren Schuldendienst sich bei Abwertungen verteuern würde. Im Interesse von Industrie und Landwirtschaft wäre eher eine Abwertung. Doch diese Interessen spielen bei der zwischen IWF, Europäischer Kommission und nationalen Regierungen akkordierten Politik keine Rolle. Kern der Strukturanpassungspolitik sind reale und oft auch nominale Kürzungen der Gehälter der öffentlich Bediensteten und der Sozialleistungen. Statt abzuwerten soll durch eine scharf deflationäre Politik die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt werden (vgl. Becker 2009). Das ohnehin schwache produktive Potenzial erodiert so noch weiter. Der Beitritt zur Euro-Zone soll eine offene Währungskrise verhindern. Er würde aber die wirtschaftliche und soziale Misere festschreiben. Denn bei den gegen- wärtigen Wechselkursen ist das einheimische produktive Gewerbe chancenlos. Außerdem unterliegt, wie am Fall Griechenlands derzeit deutlich wird, die Euro-Zone bereits jetzt sehr starken Spannungen zwischen Ländern mit strukturellen Leistungsbilanzüberschüssen und ‑defiziten.
Schlussfolgerungen
Die Wirtschaftspolitik in der EU ist primär auf die Finanzinteressen zugeschnitten – dies zeigt sich in der üppigen Bemessung der Stützungspakete für die Banken, in den Versuchen zur Wiederbelebung der Finanzmärkte, im regulatorischen Minimalismus wie auch im sturen Festhalten an den überbewerteten Paritäten in Osteuropa. Im fiskalischen Bereich wird der wirtschaftspolitische Bruch zwischen Zentrum und Peripherie in der EU ganz besonders deutlich – eine leichte Stimulierung im Zentrum, hingegen eine prozyklische Politik in den Ländern der EU-Peripherie mit hohen Leistungs- und Handelsbilanzdefiziten. Die Spaltung der EU in Zentrums- und Peripherieländer wird verstärkt. Die Lohnsenkungspolitik in den Ländern der Peripherie verschärft die soziale Ungleichheit weiter und wird auch auf die Löhne im Zentrum Druck ausüben. Die Anti-Krisen-Politik geht zu Lasten der Lohnabhängigen. Notwendig wäre hingegen eine deutlich forcierte Stimulierungspolitik, die auch von einem realen Lohnwachstum getragen wäre, in den Ländern mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen, vor allem Deutschlands.
Eine solche Politik könnte die Spannung in der EU mindern.
Der Beitrag ist im EU-Infobrief Nr. 1/März 2010 der AK Wien erschienen.
Literaturhinweise:
Becker, Joachim (2008) Der Drang nach Osten: Wirtschaftliche Interessen und geopolitische Strategien. In: Kurswechsel, Nr. 4, 5–29
Becker, Joachim (2009) Osteuropa in der Finanzkrise: Ein neues Argentinien? In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 54(6), 97–105
Eurostat (2010) BIP in der Eurozone und in der EU27 um 0,1% gestiegen, Eurostat-Pressemitteilung, Euroindikatoren 22/2010 – 12. Februar 2010
Galgóczi, Béla (2009) Central and Eastern Europe five years after: from „emerging Europe“ to „submerging Europe“? ETUI Policy Brief, 4/2009
Workie, Membere et al. (2009) Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza. Príčiny – náklady – východiská. Bratislava
Mythen-umrankte Bankensteuer
Die in Österreich geplante Bankensteuer macht Schlagzeilen, und Bundeskanzler Faymann macht so viel PR-Wind darum, dass man fürchten muss, er werde im Abtausch für diese geringfügige Maßnahme überproportional große Zugeständnisse an den Koalitionspartner bei der Verteilung der weiteren Budgetkonsolidierungs-Belastungen machen. Um das vorzubereiten, schlagen die Betroffenen und ihre Verbündeten jedenfalls mal mächtig Alarm – nicht immer mit sehr überzeugenden Argumenten. Eine kleine Auswahl:
„Abwanderung der Konzernzentralen nach Osteuropa als Folge der Einführung der Bankensteuer“: Da kann man nur sagen: Viel Spaß, wenn die nächste Finanzkrise kommt! Werden die Banken in ihren neuen Standorten in osteuropäischen Staaten dann genauso großzügig mit steuerfinanzierten Bankenpaketen gerettet werden wie vom österreichischen Staat im Herbst 2008? Angesichts der Minimal- bis Null-Pakete in den östlichen Nachbarstaaten in der jetzigen Krise und den düsteren wirtschaftlichen und budgetären Aussichten in den betroffenen Ländern kaum vorstellbar.
„Im Gegensatz zu den US-Banken sind österreichische Banken unschuldige Opfer der Krise“: Zwar ist der Anteil des spekulativen Eigenhandels in österreichischen Banken relativ klein. Doch die österreichischen Banken haben als Kundschaft durchaus versucht, an den Ertragsversprechen spekulativer Geschäfte in den USA und anderswo mitzunaschen. Und auch das vielbeschworene konservative Geschäftsmodell ist durch Überdehnung zu einem volkswirtschaftlichen Risiko geworden. Das österreichische Bankenpaket zählt mit rund 30% des BIP zu den größten in der EU – warum bloß? Weil die österreichischen Banken in den letzten Jahren aggressiv expandiert haben, vor allem im jetzt wackelnden Osteuropa. Mehr dazu im neuen BEIGEWUM-Buch „Mythen der Krise“.
„Die Steuer wird ohnehin an die Kundschaft weitergegeben“: Wenn Brancheninsider das als gesichertes Wissen vor sich hertragen, ist das ein Hinweis auf mangelnden Wettbewerb im Bankensektor, ja auf ein Fortbestehen verbotener informeller Preisabsprachen. Ein deutlicher Aufruf zum Einschreiten der Wettbewerbsbehörde. Und selbst wenn es zu einer Überwälzung kommt, ist immer noch die Frage, in welcher Form: Eine allgemeine Erhöhung von Gebühren für Basisdienstleistungen wie Kontoführung wirkt unter Verteilungsgesichtspunkten eher regressiv, eine Senkung der Sparzinsen eher proportional, eine Erhöhung spezieller Transaktionsgebühren vielleicht sogar progressiv.
Solidarisches Europa?
Das Projekt Europa war nie in erster Linie ein soziales Projekt, und es ist kein Projekt, dass die Konzeption der standartorientierten Wettbewerbsstaaten in Frage gestellt hätte. Zaghafte Ansätze mögen vorhanden gewesen sein, im Wesentlich versuchen die Staaten aber nach wie vor, ihre Volkswirtschaft zu Lasten anderer Staaten besserzustellen. Aktuell lässt sich das Resultat an mindestens zwei Beispielen sehen.
Steueroasen
Steuerbetrug ist Diebstahl am öffentlichen Eigentum. Die Wahrung eines strikten Bankgeheimnisses ist die Beihilfe zu diesem Diebstahl. So versuchen Staaten wie die Schweiz und Liechtenstein, aber eben auch Österreich sich zu Lasten anderer Staaten zu bereichern, indem durch ein rigoroses Bankgeheimnis verhindert wird, dass die umliegenden Staaten die ihnen zustehenden Steuern eintreiben können. Dagegen wehrt sich Deutschland nun mit dem Aufkauf der ominösen Steuerdaten-CD aus der Schweiz. Und die Schweiz keilt zurück, wobei die Steuerflucht auch gerne mal als „Notwehr“ vor den hohen Steuern genannt wird. Dabei wird – wie immer bei solchen Debatten – außer Acht gelassen, dass die Spitzenverdiener nur deswegen so viel verdienen, weil es in Europa eine entsprechende Infrastruktur an Bildung, Straßen, Schienen, (Rechts-)Sicherheit usw. gibt, die eben steuerfinanziert werden. Es ist eben meistens nicht – oder nicht nur – die „eigene Leistung“, die den Erfolg bringt. Daneben sorgt diese „Notwehr“ dafür, dass soziale Leistungen nicht oder nur vermindert erbracht werden.
Ökonomische Ungleichgewichte
Deutschland hat zwar in der Frage des Steuerbetrugs recht, aber auch die Bundesrepublik verhält sich keineswegs so, wie es ein solidarisches Europa erfordern würde. Seit Jahren werden die Lohnkosten gedrückt und die Binnennachfrage stranguliert, um als „Exportweltmeister“ andere Länder zu zwingen, sich in Deutschland zu verschulden. Das geht einerseits gegen die Bevölkerung in Deutschland; die Verteilung wird immer ungleicher. Andererseits ist dies aber auch ein Angriff auf andere Staaten, da diese sich entweder bei Deutschland verschulden oder selbst eine Dumpingpolitik betreiben müssen. Eine nachhaltige Entwicklung in Europa sieht anders aus. Griechenland gehört mit Sicherheit zu den Ländern, das – neben der eigenen Fehler – unter dem „Exportweltmeister“ leidet. Solche Ungleichgewichte – noch dazu in einem einheitlichen Währungsraum – sind auf Dauer fatal.
Was Europa wirklich braucht sind weder Steueroasen noch Lohndumping, weder Steuerwettbewerb noch sinnlose Deregulierungen. Europa muss ein Europa für die Menschen werden – mit sozialen Mindeststandards, die kontinuierlich ausgebaut werden, mit einer stärkeren Besteuerung der Kapitaleinkünfte, mit starken Regulierungen und mit dem Ziel eines sozialen und nachhaltigen Wirtschaftens. Dazu allerdings müssen die nationalen Egoismen, die der Mehrheit der BürgerInnen sowieso nur schaden, aufgegeben werden.
„Bologna“ – und weiter?
von Klemens Himpele und Oliver Prausmüller. Ist im Debattenforum der Zeitschrift Kurswechsel erschienen: Ausgabe 1/2010, S. 113–117.
Als der heute heftig diskutierte „Bologna-Prozess“ Ende der 1990er-Jahre entstand, konnte in Europa bereits auf zwei Jahrzehnte Reformologie für die „standortgerechte Dienstleistungshochschule“ zurückgeblickt werden. Die hochschulpolitische Debatte war in vielen Ländern – wenn auch in unterschiedlichen Tempi – in eine ähnliche Richtung verlaufen: Eine stärker „marktorientierte Umgebung“ und klamme öffentlichen Finanzen würden mehr Wettbewerbsorientierung an den Hochschulen erfordern; dafür sei mithin ein „gestärkter Führungskern“ notwendig, der mit genügend „Autorität“ für die Implementierung des „New Public Management“ ausgestattet ist; es brauche eine „Diversifizierung“ der Finanzierungsbasis; die Hochschulen müssten mehr „vermarktbare Dienstleistungen“ liefern etc. (vgl. Bultmann 1996; Österreichische HochschülerInnenschaft/Paulo Freire Zentrum 2005; Zeuner 2007; EURYDICE 2000; Maassen/Olsen 2007). Der seinerzeit vornehmlich nationalstaatliche Bezugsrahmen der Hochschulpolitik soll nicht über die europäischen Dimensionen der Neoliberalisierungs-Dynamiken hinwegtäuschen, in die der Aufstieg der „standortgerechten Dienstleistungshochschule“ in einem erweiterten Sinne eingebettet ist (vgl. Bieling 2004). Nur basiert dieser zu gewichtigen Teilen auf Politiken, die ohne Bezüge auf einen europäischen Hochschulraum Wirkmächtigkeit entfaltet haben.
Angesichts der im Zuge der Studierendenproteste aufgeflammten Debatten stellt sich nun die Frage, wie die formalisierte, wenn auch rechtlich nicht bindende Europäisierung des Hochschulraums den unternehmerischen Umbau der Hochschulen (weiter) beeinflusst hat. Klar ist einerseits, dass „Bologna“ Strukturen schafft, die einen europäischen Bildungsmarkt erst ermöglichen. Zudem können ungeliebte Reformen durchgesetzt werden, indem nationalstaatlich auf den vermeintlichen Sachzwang „Bologna“ verwiesen wird. Damit kann der Prozess von den Akteuren durchaus implizit als Instrument zur Umstrukturierung des Hochschulsystems angelegt worden sein (vgl. Martens et al. 2006). Andererseits ist auch immer wieder auf die Potenziale des Bologna-Prozesses zu verweisen, etwa im Bereich der sozialen Öffnung. Es stellt sich mithin heute die Frage, ob „Bologna“ „an sich“ ein Teil des Problems ist, oder ob die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die eine bestimmte Tendenz des Bologna-Prozesses in den Vordergrund rücken lassen, das Problem sind.
Andreas Keller (2003) kommt zu der Einschätzung, dass der Bologna-Prozess eine neoliberale Umstrukturierung des europäischen Hochschulwesens begünstigen kann, ebenso wie er in der Lage ist, emanzipatorische hochschulpolitische Entwicklungen in Gang zu setzen. Keller macht damit deutlich, dass der Bologna-Prozess von Beginn an umkämpft war. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass in den Bologna-Dokumenten einerseits positiv auf die Lissabon-Strategie Bezug genommen wird. Diese steht unter dem Ziel, die EU bis 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. Entlang dieser Logik braucht es inbesondere eine Optimierung der Humankapitalproduktion: „Die Studierenden sollten für den Arbeitsmarkt möglichst effizient und kostengünstig ‚beschäftigungsfähig‘ gemacht werden“ (Hirsch 2008, S. 23). Dieser Verengung des Bildungsbegriffs entspricht die Überlagerung der Studienreformdebatten durch Studienzeitverkürzungen, einer Engführung der Praxisorientierung – und gipfelt im Unwort der „Employability“. Auf der anderen Seite betonen die Dokumente der Bologna-Folgekonferenzen die Bedeutung der sozialen Dimension und die öffentliche Verantwortung für das Bildungssystem. Ferner sind die Erhöhung der Mobilität, das Durchbrechen der Versäulung zwischen akademischer und dualer Ausbildung und die Öffnung der Hochschulen für Menschen ohne traditionelle Hochschulzugangsberechtigung als positive Ziele zu benennen (vgl. Banscherus et al. 2009). Diese sind in der praktischen Ausgestaltung jedoch kaum zum Zug gekommen. Ob sich das durch die europaweiten Proteste ändert, ist derzeit offen.
Die Ambivalenz des Bologna-Prozesses lässt sich auch in der Auseinandersetzung progressiver Kräfte erkennen. Torsten Bultmann (2007) identifiziert hier zwei zentrale Positionierungen: Erstens diene der Prozess der Kommodifizierung wissenschaftlicher Bildung und stelle somit „lediglich eine Eins-zu-Eins Umsetzung neoliberaler Konzepte dar“ (S. 148). Maßgebend sei dabei ein Qualifikationsbegriff, demzufolge das „Eintrainieren eines instrumentell abrufbaren arbeitsmarktrelevanten ‚Wissens‘ Vorrang hat vor der Aneignung einer selbstständigen wissenschaftlichen Urteilsfähigkeit“ (ebd.). In diese Richtung weisen etwa die Kritiken an der zentralen Stellung von Employability-Konzepten in dem Reformprozess. Zweitens sei dieser vor allem mit verkappter Sparpolitik assoziiert, die in Verbindung mit einem „konservativen Roll-back der Massenuniversität“ (ebd.) steht. Die Etablierung des sechssemestrigen Bachelors sei entlang dieser Position gleichsam wegbereitend dafür, den Zugang zum bisherigen „Regelabschluss“ selektiver zu gestalten bzw. stärker zu konditionalisieren. Bultmann weist zwar darauf hin, dass für diese Schlussfolgerungen zweifelsfrei Anhaltspunkte bestehen. Ebenso lassen sich gut organisierte Interessen identifizieren, denen diese Motive zugeordnet werden können. Sein Einwand läuft jedoch grundsätzlich darauf hinaus, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Bologna-Prozess nicht in einem „bloß entlarvenden Hinweis“ auf die neoliberalen Motive zentraler Akteure des Prozesses erschöpfen kann. Damit bliebe gerade auch eine Politisierung der Widersprüche und Spannungsfelder, die im Bologna-Prozess angelegt sind, aus.
Entlang dieses Einwands müssen die Spannungsfelder, die im Bologna-Prozess präsent sind, stärker kenntlich gemacht werden. Diesen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, könnte gleichsam eine Möglichkeit darstellen, die durch die Studierendenproteste geschaffenen politischen Interventionsmöglichkeiten auch in diesem Zusammenhang zu nutzen.
- Wird der Bologna-Prozess vor dem Hintergrund der Bestrebungen perspektiviert, einen globalen Bildungsmarkt zu konstituieren (vgl. Hartmann 2004, Anthofer 2005), birgt das in den Dokumenten enthaltende Bekenntnis zu Hochschulbildung als einem „öffentlichen Gut“ einen Ansatzpunkt, eine alternative „Verlaufsform“ der Europäisierung einzufordern. Was mit diesem (Lippen?-)Bekenntnis geschieht, gewinnt u.a. angesichts der forcierten Strategie an Bedeutung, den Wunsch höherer Bildungsausgaben über die verstärkte Erschließung privater Finanzierungsquellen zu erreichen. Hier setzt beispielsweise die deutsche Bildungsgewerkschaft GEW an, indem sie die Unterzeichnerstaaten der Bologna-Erklärung dazu auffordert, die Realisierung des im Internationalen Pakts für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) verbürgten Rechts auf Bildung im gesamten europäischen Hochschulraum zu realisieren. Dies soll auch dadurch erfolgen, dass „der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss“ (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c UN Sozialpakt). Die Verknüpfung des Bekenntnisses zu Bildung als einem öffentlichen Gut mit den Forderungen des UN-Sozialpakts könnte demnach als Ansatzpunkt genutzt werden, die Debatte über den Bildungsbegriff und über die soziale Durchlässigkeit von Bildungssystemen neu zu entfachen. Dazu gehört beispielsweise auch ein gebührenfreier europäischer Hochschulraum.
- In den Bologna-Dokumenten wird wiederholt die soziale Dimension betont, ohne dass dies bisher nachhaltige Änderungen nach sich gezogen hätte. Die Frage der Aufnahme eines Studiums ist stark mit dem familiären Hintergrund korreliert. Noch immer studieren deutlich mehr Kinder aus sogenannten bildungsnahen Elternhäusern. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. So werden Kinder durch diese Eltern in der Regel stärker gefördert, es sind größere Ressourcen vorhanden, das Verständnis für eine Bildungskarriere ist größer und die Selbstverständlichkeit, bestimmte Bildungswege bis hin zu einem Studienabschluss zu beschreiten, vorhanden. Kinder, deren Eltern selbst nicht studiert haben, müssen sich oft erst gegen diese durchsetzen und haben oft eine unsichere Einschätzung von einem Studium und scheuen die Kosten eines Studiums eher. Gerade hier hätte die neue Stufung der Studiengänge ansetzen können, indem der Bachelor genutzt wird, ein zugänglicheres Studium auch für Menschen anzubieten, die bisher vor einem langen Magisterstudium zurückgeschreckt sind. Die Entscheidung für ein Studium könnte erleichtert werden, wenn man bei der Konzeption der Studiengänge eben diese bildungsfernen Schichten mitdenkt und auch bereit ist, den elitären Habitus der Hochschulen zu durchbrechen. Geschehen ist das Gegenteil: Die Studiengänge werden immer weiter geschlossen. Auch die Frage des Übergangs zum Master fällt unter das Stichwort „Soziale Dimension“: Anstatt zu versuchen, das Dogma der Studienzeitverkürzung umzusetzen, indem man Zugänge zum Master beschränkt, ist das Studium auch an dieser Hürde zu öffnen, um allen, die wollen, einen Zugang zum Master zu ermöglichen.
- Der Bologna-Prozess muss dazu genutzt werden, einen sinnvollen Praxisbegriff zu entwickeln. Nicht die Engführung auf „Employability“, sondern die Frage der gesellschaftlichen Relevanz ist hier in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade kritische Kräfte sollten die Debatte um den Praxisbegriff offensiv führen. Dafür braucht es mithin mehr als das Wegschieben der „Praxisfrage“ in Richtung Fachhochschulen.
- Die Versäulung zwischen akademischer und handwerklicher Ausbildung ist aufzubrechen. Der Bologna-Prozess stellt hier durchaus Instrumente bereit, wenn die konsekutive Struktur zur Öffnung der Hochschulen etwa für Menschen mit Berufserfahrung genutzt wird. Dies erfordert jedoch Veränderungen in der Arbeitswelt und an den Hochschulen. So sind kulturelle Hürden zu überwinden und die Hochschulen tatsächlich für beruflich Qualifizierte zu öffnen. Zudem ist der Praxisorientierung der Wissenschaft eine Verwissenschaftlichung der Praxis zur Seite zu stellen (vgl. Banscherus et al. 2009).
Die Studierendenproteste waren insofern erfolgreich, als sie bestimmte Themen auf die politische Tagesordnung gesetzt und den öffentlichen Diskurs verschoben haben. Bisher galt das Leitbild der neoliberalen Strukturreform: Hochschulen sollten zu standortgerechten Dienstleistungsunternehmen umgebaut werden, die im Wettbewerb um die Studierenden als zahlende KundInnen werben und diesen mit einem Ausbildungszertifikat die Beschäftigungsfähigkeit attestieren. Bildung wird hier weiterführend als Ware verstanden, das Studium mit einer Investition in das eigene Humankapital verbunden (und nicht etwa mit dem Ziel eines Erkenntnisgewinns). In dieser Richtung kann auch der Bologna-Prozess interpretiert werden: Denn wird „der Bildungs- und Wissenschaftsmarkt, auf dem die Hochschulen in einen Wettbewerb um Nachfrager treten, europaweit konstituiert, bedarf es einer europaweiten Kompatibilität und Übertragbarkeit. Zentrales Instrumentarium für die Herstellung der Übertragbarkeit von Studienleistungen ist ein einheitliches Leistungspunktsystem – gleichsam die gemeinsame ‚Währung´ im europäischen Studienraum, die Studienleistungen messbar und vergleichbar macht. Die europaweit einheitliche Messbarkeit von Studienleistungen bzw. den ihnen zugrunde liegenden Studiendienstleistungen könnte in einem weiteren Schritt zur Voraussetzung für eine international vergleichbare Berechnung von durch die Studierenden zu bezahlenden Gebühren oder für ein europaweit geltendes Bildungsgutscheinsystem werden“ (Keller 2003, S. 44).
Nicht nur im europäischen, sondern auch im nationalen Kontext wurde der Bologna-Prozess oft neoliberal interpretiert: Marktkonforme Disziplinierung der Studierenden in einem stark verschulten „Ausbildungsbetrieb“, Bildung als Investition in die „Ich-AG“, Employability als Ziel und das Einziehen einer weiteren selektiven Hierarchieebene beim Übergang vom Bachelor zum Master. Zudem verbinden nationale Akteure mit Europäisierung vor allem die Möglichkeit des Spiels über Bande: Unpopuläre Änderungen und eigenes Versagen bei Studienreformen und der Finanzierung der Hochschulen können auf „Europa“ gebucht und so der eigenen Verantwortung entledigt werden.
Die Studierendenproteste haben den Fokus jedoch auf die Potentiale des Prozesses gelegt, da sie in ein erhebliches inhaltliches Vakuum gestoßen sind. Im März soll die Vollendung des europäischen Hochschulraums gefeiert werden, bisweilen steht in den offiziellen Vorbereitungen eines „Follow-up für die nächste Dekade“ Selbstbeweihräucherung im Vordergrund*. Viele Akteure sind irritiert bis ratlos, was die Chancen gezielter Interventionen erhöht. In vielen Fällen können derzeit eher Fragen formuliert als Antworten gegeben werden. Die Debatte über eine neue Architektur des europäischen Hochschulraums könnte jedoch umso mehr dazu beitragen, neue Handlungsspielräume für kritisches Studieren, Lehren und Forschen zu erschließen.
* vgl. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung; zur „Gegen-Mobilisierung“ siehe Bolgnaburns.
Literatur:
- Anthofer, Helmut (2005): GATS und die Liberalisierung von Bildungsdienstleistungen. Eine Bestandsaufnahme, Wien, PDF [2,8 MB].
- Banscherus, Ulf / Gulbins, Annerose / Himpele, Klemens / Staack, Sonja (2009): Der Bologna-Prozess zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die europäischen Ziele und ihre Umsetzung in Deutschland. Eine Expertise im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung, Frankfurt/M., PDF [800 KB].
- Bieling, Hans-Jürgen (2004): Europäische Integration: Determinanten und Handlungsmöglichkeiten, in: Beerhorst, Joachim/et al. (Hg.): Kritische Theorie im gesellschaftlichen Strukturwandel, Frankfurt/M., 94–127.
- Bultmann, Torsten (1996): Die standortgerechte Dienstleistungshochschule, in: PROKLA, 26/104, 329–355, PDF [3,7 MB].
- Bultmann, Torsten (2007): Künftige Perspektiven von Wissenschaft und Beruf – Widersprüche und Konfliktlinien des Bolognaprozesses und der Reorganisation der Hochschulen. In: Brüchert, Oliver/et al. (Hg.): Kritische Wissenschaft, Emanzipation und die Entwicklung der Hochschulen, Marburg, 147–154.
- EURYDICE (2000): Two Decades of Reform in Higher Education in Europe: 1980 onwards, Brüssel, PDF [3 MB].
- Hartmann, Eva (2004): Der globale Bildungsmarkt. Hegemoniekämpfe um Qualitätsstandards und Anerkennung von Abschlüssen, in: PROKLA, 34/137, 565–585, PDF [3,8 MB].
- Hirsch, Nele (2008): „Bologna-Prozess“ und der Kampf an den Hochschulen, in: Z. – Zeitschrift Marxistische Erneuerung, 19/74, 22 ‑27, Online hier.
- Keller, Andreas (2003): Chancen und Risiken des Bologna-Prozess, in: Forum Wissenschaft 3/2003, 43–45, Online hier.
- Martens, Kerstin/Wolf, Dieter (2006): Paradoxien der neuen Staatsräson. Die Internationalisierung der Bildungspolitik in der EU und der OECD, in: Zeitschrift für internationale Beziehungen, 13/2, 145–176, PDF [400 KB]
- Maassen, Peter/Olsen, Johan P. (2007): University Dynamics and European Integration, Dordrecht.
- Österreichische HochschülerInnenschaft, Paulo Freire Zentrum (Hg., 2005): Ökonomisierung der Bildung. Tendenzen, Strategien, Alternativen, Wien, PDF [700 KB].
- Zeuner, Bodo (2007): Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang. Bemerkungen zur Ökonomisierung der Wissenschaft. Abschiedvorlesung, [PDF 350 KB].
Links zuletzt geprüft am 8. Februar 2010
„Mythen der Krise“ – neues BEIGEWUM Buch!
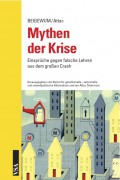 Neues BEIGEWUM Buch:
Neues BEIGEWUM Buch:
„Mythen der Krise. Einsprüche gegen falsche Lehren aus dem großen Crash“
Herausgegeben vom Beirat für gesellschafts‑, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen und von Attac Österreich
VSA Verlag, 128 Seiten (Februar 2010)
EUR 10.80
ISBN 978–3‑89965–373‑1
Zu Beginn der aktuellen Krise schien der Neoliberalismus, ja der Kapitalismus insgesamt, schweren Legitimationsschaden zu nehmen. Doch mittlerweile haben sich seine Apologeten erholt und versuchen mit allen Mitteln, ihre Lehren zu verteidigen.
Mit Mythen wie „Der Staat ist schuld an der Krise“ oder „Europa ist nur Opfer“ wird Ursachenverleugnung betrieben. Mit Ansagen wie „Jetzt droht die Hyperinflation“, „Wir vererben nachfolgenden Generationen Schulden ohne Ende“ oder „Jetzt müssen alle den Gürtel enger schnallen“, wird versucht, eine Abkehr von der herrschenden wirtschaftspolitischen Doktrin zu verhindern. Mit Warnungen wie „Die Banken sind um jeden Preis zu retten“ wird beschleunigt in Sackgassen gesteuert. Doch auch kritisch auftretende Ansätze wie die Zinskritik versuchen die Krise zu nutzen, um für ihre Irrlehren zu werben.
Die AutorInnen nehmen sich die kursierenden Mythen vor und ordnen sie in die Bereiche Krisenursachen, Krisenbeschreibung sowie Krisenlösungen ein. Die auch für Nicht-ÖkonomInnen eingängige Darstellung und das Aufgreifen von hartnäckig wirkenden Vorurteilen machen ihr Buch zu einer willkommenen Argumentationshilfe für all jene, die dem herrschenden Krisen-Management kenntnisreich entgegen treten wollen.
Präsentation am Di, 16.3. 2010 um 19h in der Städtischen Bücherei Wien am Urban Loritz Platz mit Karin Küblböck, Markus Marterbauer und Georg Feigl: „Alle Gürtel enger schnallen, sonst droht der Staatsbankrott und andere Mythen der Krise“
Weitere Termine:
10. Februar 16h und Freitag, 12. Februar 9h05: Interview mit Co-Autor Beat Weber in der Ö1-Sendung „Kontext – Sachbücher und Themen“
24. März 2010 um 18h an der WU Wien, Hs. 5.46 © mit Helene Schuberth, Elisabeth Springler und Beat Weber
19. April 2010 um 19h Buchpräsentation und Diskussion mit Katharina Muhr (BEIGEWUM) im Kulturhof Amstetten
Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis (PDF)
Textprobe: Mythos – Alle müssen Gürtel enger schnallen (PDF)