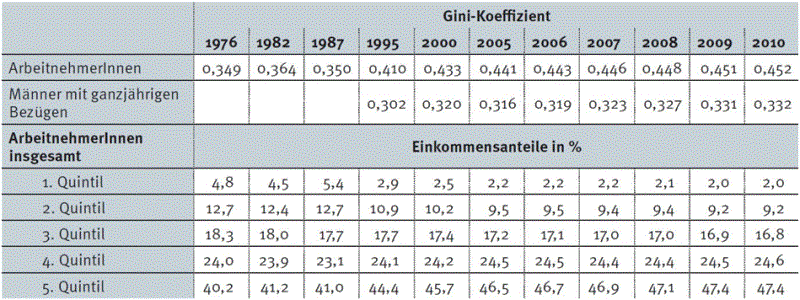„Erbschaften besteuern!“ ist einmal mehr gefragt
Ende 2013 startete die Initiative „Erbschaften besteuern!“, für die wir damals eine eigene Homepage angelegt haben. Nun gewinnt die Forderung nach mehr Verteilungsgerechtigkeit erneut an Dringlichkeit – denn die Steuerreform der Bundesregierung droht zu einem...